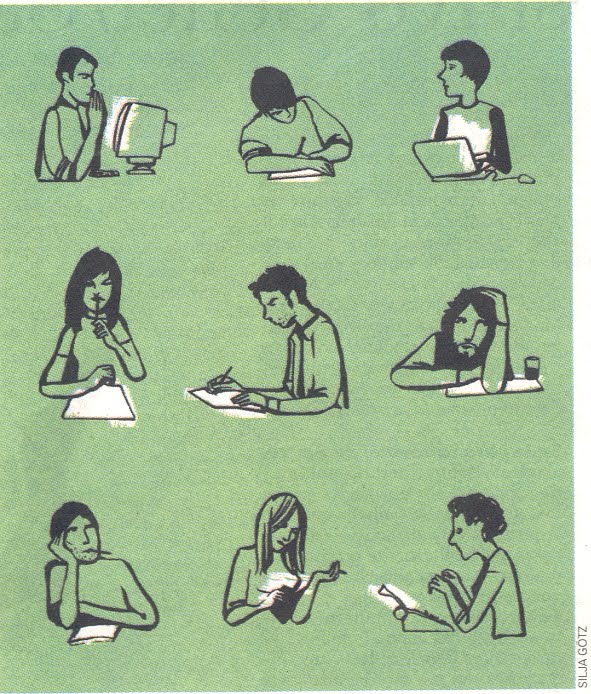|
| capa da 1º edición, 1925 |
die Verhaftung
Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er
etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Die Köchin der Frau
Grubach, seiner Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen acht Uhr früh das
Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. K.
wartete noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm
gegenüber wohnte und die ihn mit einer an ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde
beobachtete, dann aber, gleichzeitig befremdet und hungrig, läutete er. Sofort klopfte es und ein Mann, den er in dieser Wohnung noch niemals
gesehen hatte, trat ein. Er war schlank und doch fest gebaut, er trug ein
anliegendes schwarzes Kleid, das, ähnlich den Reiseanzügen, mit verschiedenen
Falten, Taschen, Schnallen, Knöpfen und einem Gürtel versehen war und
infolgedessen, ohne daß man sich darüber klar wurde, wozu es dienen sollte,
besonders praktisch erschien. »Wer sind Sie?« fragte K. und saß gleich halb
aufrecht im Bett. Der Mann aber ging über die Frage hinweg, als müsse man seine
Erscheinung hinnehmen, und sagte bloß seinerseits: »Sie haben geläutet?« »Anna
soll mir das Frühstück bringen«, sagte K. und versuchte, zunächst
stillschweigend, durch Aufmerksamkeit und Überlegung festzustellen, wer der
Mann eigentlich war. Aber dieser setzte sich nicht allzulange seinen Blicken
aus, sondern wandte sich zur Tür, die er ein wenig öffnete, um jemandem, der
offenbar knapp hinter der Tür stand, zu sagen: »Er will, daß Anna ihm das
Frühstück bringt.« Ein kleines Gelächter im Nebenzimmer folgte, es war nach dem
Klang nicht sicher, ob nicht mehrere Personen daran beteiligt waren. Obwohl der
fremde Mann dadurch nichts erfahren haben konnte, was er nicht schon früher
gewußt hätte, sagte er nun doch zu K. im Tone einer Meldung: »Es ist unmöglich.«
»Das wäre neu«, sagte K., sprang aus dem Bett und zog rasch seine Hosen an.
»Ich will doch sehen, was für Leute im Nebenzimmer sind und wie Frau Grubach
diese Störung mir gegenüber verantworten wird.« Es fiel ihm zwar gleich ein,
daß er das nicht hätte laut sagen müssen und daß er dadurch gewissermaßen ein
Beaufsichtigungsrecht des Fremden anerkannte, aber es schien ihm jetzt nicht
wichtig. Immerhin faßte es der Fremde so auf, denn er sagte: »Wollen Sie nicht
lieber hierbleiben?« »Ich will weder hierbleiben, noch von Ihnen angesprochen
werden, solange Sie sich mir nicht vorstellen.« »Es war gut gemeint«, sagte der
Fremde und öffnete nun freiwillig die Tür. Im Nebenzimmer, in das K. langsamer
eintrat, als er wollte, sah es auf den ersten Blick fast genau so aus wie am
Abend vorher. Es war das Wohnzimmer der Frau Grubach, vielleicht war in diesem
mit Möbeln, Decken, Porzellan und Photographien überfüllten Zimmer heute ein
wenig mehr Raum als sonst, man erkannte das nicht gleich, um so weniger, als die
Hauptveränderung in der Anwesenheit eines Mannes bestand, der beim offenen
Fenster mit einem Buch saß, von dem er jetzt aufblickte. »Sie hätten in Ihrem
Zimmer bleiben sollen! Hat es Ihnen denn Franz nicht gesagt?« »Ja, was wollen
Sie denn?« sagte K. und sah von der neuen Bekanntschaft zu dem mit Franz
Benannten, der in der Tür stehengeblieben war, und dann wieder zurück. Durch
das offene Fenster erblickte man wieder die alte Frau, die mit wahrhaft
greisenhafter Neugierde zu dem jetzt gegenüberliegenden Fenster getreten war,
um auch weiterhin alles zu sehen. »Ich will doch Frau Grubach -«, sagte K.,
machte eine Bewegung, als reiße er sich von den zwei Männern los, die aber weit
von ihm entfernt standen, und wollte weitergehen. »Nein«, sagte der Mann beim Fenster,
warf das Buch auf ein Tischchen und stand auf. »Sie dürfen nicht weggehen, Sie
sind ja verhaftet.« »Es sieht so aus«, sagte K. »Und warum denn?« fragte er
dann. »Wir sind nicht dazu bestellt, Ihnen das zu sagen. Gehen Sie in Ihr
Zimmer und warten Sie. Das Verfahren ist nun einmal eingeleitet, und Sie werden
alles zur richtigen Zeit erfahren. Ich gehe über meinen Auftrag hinaus, wenn
ich Ihnen so freundschaftlich zurede. Aber ich hoffe, es hört es niemand sonst
als Franz, und der ist selbst gegen alle Vorschrift freundlich zu Ihnen. Wenn
Sie auch weiterhin so viel Glück haben wie bei der Bestimmung Ihrer Wächter,
dann können Sie zuversichtlich sein.« K. wollte sich setzen, aber nun sah er,
daß im ganzen Zimmer keine Sitzgelegenheit war, außer dem Sessel beim Fenster.
»Sie werden noch einsehen, wie wahr das alles ist«, sagte Franz und ging
gleichzeitig mit dem andern Mann auf ihn zu. Besonders der letztere überragte
K. bedeutend und klopfte ihm öfters auf die Schulter. Beide prüften K.s
Nachthemd und sagten, daß er jetzt ein viel schlechteres Hemd werde anziehen
müssen, daß sie aber dieses Hemd wie auch seine übrige Wäsche aufbewahren und,
wenn seine Sache günstig ausfallen sollte, ihm wieder zurückgeben würden. »Es
ist besser, Sie geben die Sachen uns als ins Depot«, sagten sie, »denn im Depot
kommen öfters Unterschleife vor und außerdem verkauft man dort alle Sachen nach
einer gewissen Zeit, ohne Rücksicht, ob das betreffende Verfahren zu Ende ist
oder nicht. Und wie lange dauern doch derartige Prozesse, besonders in letzter
Zeit! Sie bekämen dann schließlich allerdings vom Depot den Erlös, aber dieser
Erlös ist erstens an sich schon gering, denn beim Verkauf entscheidet nicht die
Höhe des Angebotes, sondern die Höhe der Bestechung, und weiter verringern sich
solche Erlöse erfahrungsgemäß, wenn sie von Hand zu Hand und von Jahr zu Jahr
weitergegeben werden.« K. achtete auf diese Reden kaum, das Verfügungsrecht
über seine Sachen, das er vielleicht noch besaß, schätzte er nicht hoch ein,
viel wichtiger war es ihm, Klarheit über seine Lage zu bekommen; in Gegenwart
dieser Leute konnte er aber nicht einmal nachdenken, immer wieder stieß der
Bauch des zweiten Wächters - es konnten ja nur Wächter sein - förmlich freundschaftlich
an ihn, sah er aber auf, dann erblickte er ein zu diesem dicken Körper gar
nicht passendes trockenes, knochiges Gesicht mit starker, seitlich gedrehter
Nase, das sich über ihn hinweg mit dem anderen Wächter verständigte. Was waren
denn das für Menschen? Wovon sprachen sie? Welcher Behörde gehörten sie an? K.
lebte doch in einem Rechtsstaat, überall herrschte Friede, alle Gesetze
bestanden aufrecht, wer wagte, ihn in seiner Wohnung zu überfallen? Er neigte
stets dazu, alles möglichst leicht zu nehmen, das Schlimmste erst beim Eintritt
des Schlimmsten zu glauben, keine Vorsorge für die Zukunft zu treffen, selbst
wenn alles drohte. Hier schien ihm das aber nicht richtig, man konnte zwar das
Ganze als Spaß ansehen, als einen groben Spaß, den ihm aus unbekannten Gründen,
vielleicht weil heute sein dreißigster Geburtstag war, die Kollegen in der Bank
veranstaltet hatten, es war natürlich möglich, vielleicht brauchte er nur auf
irgendeine Weise den Wächtern ins Gesicht zu lachen, und sie würden mitlachen,
vielleicht waren es Dienstmänner von der Straßenecke, sie sahen ihnen nicht
unähnlich - trotzdem war er diesmal, förmlich schon seit dem ersten Anblick des
Wächters Franz, entschlossen, nicht den geringsten Vorteil, den er vielleicht
gegenüber diesen Leuten besaß, aus der Hand zu geben. Darin, daß man später
sagen würde, er habe keinen Spaß verstanden, sah K. eine ganz geringe Gefahr,
wohl aber erinnerte er sich - ohne daß es sonst seine Gewohnheit gewesen wäre,
aus Erfahrungen zu lernen - an einige, an sich unbedeutende Fälle, in denen er
zum Unterschied von seinen Freunden mit Bewußtsein, ohne das geringste Gefühl
für die möglichen Folgen, sich unvorsichtig benommen hatte und dafür durch das
Ergebnis gestraft worden war. Es sollte nicht wieder geschehen, zumindest nicht
diesmal; war es eine Komödie, so wollte er mitspielen.
Noch war er frei. »Erlauben Sie«, sagte er und ging eilig zwischen den Wächtern durch in sein Zimmer. »Er scheint vernünftig zu sein«, hörte er hinter sich sagen. In seinem Zimmer riß er gleich die Schubladen des Schreibtischs auf, es lag dort alles in großer Ordnung, aber gerade die Legitimationspapiere, die er suchte, konnte er in der Aufregung nicht gleich finden. Schließlich fand er seine Radfahrlegitimation und wollte schon mit ihr zu den Wächtern gehen, dann aber schien ihm das Papier zu geringfügig und er suchte weiter, bis er den Geburtsschein fand. Als er wieder in das Nebenzimmer zurückkam, öffnete sich gerade die gegenüberliegende Tür und Frau Grubach wollte dort eintreten. Man sah sie nur einen Augenblick, denn kaum hatte sie K. erkannt, als sie offenbar verlegen wurde, um Verzeihung bat, verschwand und äußerst vorsichtig die Tür schloß. »Kommen Sie doch herein«, hatte K. gerade noch sagen können. Nun aber stand er mit seinen Papieren in der Mitte des Zimmers, sah noch auf die Tür hin, die sich nicht wieder öffnete, und wurde erst durch einen Anruf der Wächter aufgeschreckt, die bei dem Tischchen am offenen Fenster saßen und, wie K. jetzt erkannte, sein Frühstück verzehrten. »Warum ist sie nicht eingetreten?« fragte er. »Sie darf nicht«, sagte der große Wächter. »Sie sind doch verhaftet.« »Wie kann ich denn verhaftet sein? Und gar auf diese Weise?« »Nun fangen Sie also wieder an«, sagte der Wächter und tauchte ein Butterbrot ins Honigfäßchen. »Solche Fragen beantworten wir nicht.« »Sie werden sie beantworten müssen«, sagte K. »Hier sind meine Legitimationspapiere, zeigen Sie mir jetzt die Ihrigen und vor allem den Verhaftbefehl.« »Du lieber Himmel!« sagte der Wächter. »Daß Sie sich in Ihre Lage nicht fügen können und daß Sie es darauf angelegt zu haben scheinen, uns, die wir Ihnen jetzt wahrscheinlich von allen Ihren Mitmenschen am nächsten stehen, nutzlos zu reizen!« »Es ist so, glauben Sie es doch«, sagte Franz, führte die Kaffeetasse, die er in der Hand hielt, nicht zum Mund, sondern sah K. mit einem langen, wahrscheinlich bedeutungsvollen, aber unverständlichen Blick an. K. ließ sich, ohne es zu wollen, in ein Zwiegespräch der Blicke mit Franz ein, schlug dann aber doch auf seine Papiere und sagte: »Hier sind meine Legitimationspapiere.« »Was kümmern uns denn die?« rief nun schon der große Wächter. »Sie führen sich ärger auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Wollen Sie Ihren großen, verfluchten Prozeß dadurch zu einem raschen Ende bringen, daß Sie mit uns, den Wächtern, über Legitimation und Verhaftbefehl diskutieren? Wir sind niedrige Angestellte, die sich in einem Legitimationspapier kaum auskennen und die mit Ihrer Sache nichts anderes zu tun haben, als daß sie zehn Stunden täglich bei Ihnen Wache halten und dafür bezahlt werden. Das ist alles, was wir sind, trotzdem aber sind wir fähig, einzusehen, daß die hohen Behörden, in deren Dienst wir stehen, ehe sie eine solche Verhaftung verfügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten. Es gibt darin keinen Irrtum. Unsere Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muß uns Wächter ausschicken. Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum?« »Dieses Gesetz kenne ich nicht«, sagte K. »Desto schlimmer für Sie«, sagte der Wächter. »Es besteht wohl auch nur in Ihren Köpfen«, sagte K., er wollte sich irgendwie in die Gedanken der Wächter einschleichen, sie zu seinen Gunsten wenden oder sich dort einbürgern. Aber der Wächter sagte nur abweisend: »Sie werden es zu fühlen bekommen.« Franz mischte sich ein und sagte: »Sieh, Willem, er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht, und behauptet gleichzeitig, schuldlos zu sein.« »Du hast ganz recht, aber ihm kann man nichts begreiflich machen«, sagte der andere. K. antwortete nichts mehr; muß ich, dachte er, durch das Geschwätz dieser niedrigsten Organe - sie geben selbst zu, es zu sein - mich noch mehr verwirren lassen? Sie reden doch jedenfalls von Dingen, die sie gar nicht verstehen. Ihre Sicherheit ist nur durch ihre Dummheit möglich. Ein paar Worte, die ich mit einem mir ebenbürtigen Menschen sprechen werde, werden alles unvergleichlich klarer machen als die längsten Reden mit diesen. Er ging einige Male in dem freien Raum des Zimmers auf und ab, drüben sah er die alte Frau, die einen noch viel älteren Greis zum Fenster gezerrt hatte, den sie umschlungen hielt. K. mußte dieser Schaustellung ein Ende machen: »Führen Sie mich zu Ihrem Vorgesetzten«, sagte er. »Wenn er es wünscht; nicht früher«, sagte der Wächter, der Willem genannt worden war. »Und nun rate ich Ihnen«, fügte er hinzu, »in Ihr Zimmer zu gehen, sich ruhig zu verhalten und darauf zu warten, was über Sie verfügt werden wird. Wir raten Ihnen, zerstreuen Sie sich nicht durch nutzlose Gedanken, sondern sammeln Sie sich, es werden große Anforderungen an Sie gestellt werden. Sie haben uns nicht so behandelt, wie es unser Entgegenkommen verdient hätte, Sie haben vergessen, daß wir, mögen wir auch sein was immer, zumindest jetzt Ihnen gegenüber freie Männer sind, das ist kein kleines Übergewicht. Trotzdem sind wir bereit, falls Sie Geld haben, Ihnen ein kleines Frühstück aus dem Kaffeehaus drüben zu bringen.«
Noch war er frei. »Erlauben Sie«, sagte er und ging eilig zwischen den Wächtern durch in sein Zimmer. »Er scheint vernünftig zu sein«, hörte er hinter sich sagen. In seinem Zimmer riß er gleich die Schubladen des Schreibtischs auf, es lag dort alles in großer Ordnung, aber gerade die Legitimationspapiere, die er suchte, konnte er in der Aufregung nicht gleich finden. Schließlich fand er seine Radfahrlegitimation und wollte schon mit ihr zu den Wächtern gehen, dann aber schien ihm das Papier zu geringfügig und er suchte weiter, bis er den Geburtsschein fand. Als er wieder in das Nebenzimmer zurückkam, öffnete sich gerade die gegenüberliegende Tür und Frau Grubach wollte dort eintreten. Man sah sie nur einen Augenblick, denn kaum hatte sie K. erkannt, als sie offenbar verlegen wurde, um Verzeihung bat, verschwand und äußerst vorsichtig die Tür schloß. »Kommen Sie doch herein«, hatte K. gerade noch sagen können. Nun aber stand er mit seinen Papieren in der Mitte des Zimmers, sah noch auf die Tür hin, die sich nicht wieder öffnete, und wurde erst durch einen Anruf der Wächter aufgeschreckt, die bei dem Tischchen am offenen Fenster saßen und, wie K. jetzt erkannte, sein Frühstück verzehrten. »Warum ist sie nicht eingetreten?« fragte er. »Sie darf nicht«, sagte der große Wächter. »Sie sind doch verhaftet.« »Wie kann ich denn verhaftet sein? Und gar auf diese Weise?« »Nun fangen Sie also wieder an«, sagte der Wächter und tauchte ein Butterbrot ins Honigfäßchen. »Solche Fragen beantworten wir nicht.« »Sie werden sie beantworten müssen«, sagte K. »Hier sind meine Legitimationspapiere, zeigen Sie mir jetzt die Ihrigen und vor allem den Verhaftbefehl.« »Du lieber Himmel!« sagte der Wächter. »Daß Sie sich in Ihre Lage nicht fügen können und daß Sie es darauf angelegt zu haben scheinen, uns, die wir Ihnen jetzt wahrscheinlich von allen Ihren Mitmenschen am nächsten stehen, nutzlos zu reizen!« »Es ist so, glauben Sie es doch«, sagte Franz, führte die Kaffeetasse, die er in der Hand hielt, nicht zum Mund, sondern sah K. mit einem langen, wahrscheinlich bedeutungsvollen, aber unverständlichen Blick an. K. ließ sich, ohne es zu wollen, in ein Zwiegespräch der Blicke mit Franz ein, schlug dann aber doch auf seine Papiere und sagte: »Hier sind meine Legitimationspapiere.« »Was kümmern uns denn die?« rief nun schon der große Wächter. »Sie führen sich ärger auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Wollen Sie Ihren großen, verfluchten Prozeß dadurch zu einem raschen Ende bringen, daß Sie mit uns, den Wächtern, über Legitimation und Verhaftbefehl diskutieren? Wir sind niedrige Angestellte, die sich in einem Legitimationspapier kaum auskennen und die mit Ihrer Sache nichts anderes zu tun haben, als daß sie zehn Stunden täglich bei Ihnen Wache halten und dafür bezahlt werden. Das ist alles, was wir sind, trotzdem aber sind wir fähig, einzusehen, daß die hohen Behörden, in deren Dienst wir stehen, ehe sie eine solche Verhaftung verfügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten. Es gibt darin keinen Irrtum. Unsere Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muß uns Wächter ausschicken. Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum?« »Dieses Gesetz kenne ich nicht«, sagte K. »Desto schlimmer für Sie«, sagte der Wächter. »Es besteht wohl auch nur in Ihren Köpfen«, sagte K., er wollte sich irgendwie in die Gedanken der Wächter einschleichen, sie zu seinen Gunsten wenden oder sich dort einbürgern. Aber der Wächter sagte nur abweisend: »Sie werden es zu fühlen bekommen.« Franz mischte sich ein und sagte: »Sieh, Willem, er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht, und behauptet gleichzeitig, schuldlos zu sein.« »Du hast ganz recht, aber ihm kann man nichts begreiflich machen«, sagte der andere. K. antwortete nichts mehr; muß ich, dachte er, durch das Geschwätz dieser niedrigsten Organe - sie geben selbst zu, es zu sein - mich noch mehr verwirren lassen? Sie reden doch jedenfalls von Dingen, die sie gar nicht verstehen. Ihre Sicherheit ist nur durch ihre Dummheit möglich. Ein paar Worte, die ich mit einem mir ebenbürtigen Menschen sprechen werde, werden alles unvergleichlich klarer machen als die längsten Reden mit diesen. Er ging einige Male in dem freien Raum des Zimmers auf und ab, drüben sah er die alte Frau, die einen noch viel älteren Greis zum Fenster gezerrt hatte, den sie umschlungen hielt. K. mußte dieser Schaustellung ein Ende machen: »Führen Sie mich zu Ihrem Vorgesetzten«, sagte er. »Wenn er es wünscht; nicht früher«, sagte der Wächter, der Willem genannt worden war. »Und nun rate ich Ihnen«, fügte er hinzu, »in Ihr Zimmer zu gehen, sich ruhig zu verhalten und darauf zu warten, was über Sie verfügt werden wird. Wir raten Ihnen, zerstreuen Sie sich nicht durch nutzlose Gedanken, sondern sammeln Sie sich, es werden große Anforderungen an Sie gestellt werden. Sie haben uns nicht so behandelt, wie es unser Entgegenkommen verdient hätte, Sie haben vergessen, daß wir, mögen wir auch sein was immer, zumindest jetzt Ihnen gegenüber freie Männer sind, das ist kein kleines Übergewicht. Trotzdem sind wir bereit, falls Sie Geld haben, Ihnen ein kleines Frühstück aus dem Kaffeehaus drüben zu bringen.«
der Prozess
Franz Kafka
obra completada en 1915
traducida ao galego por Xosé María García Álvarez e publicada como
O proceso
Compostela, Sotelo Blanco, 2003
a detención
Alguén debera difamar a Josef K. porque unha mañá, sen
que nada malo fixese, foi detido. Todos os días a iso das oito, a cociñeira da
señora Grubach, a súa caseira, traíalle o almorzo; pero aquela vez non veu.
Nunca tal ocorrera antes. K. aínda agardou un anaco, ollou dende a súa almofada
a anciá que vivía en fronte e que o observaba cunha curiosidade absolutamente
impropia dela; pero logo, ó mesmo tempo estrañado e famento, tocou o timbre. De
seguido, petaron na porta; e entrou un home que nunca antes vira naquela casa.
Era delgado e non obstante rexo; levaba un traxe negro e axustado provisto, a
semellanza da roupa dos exploradores, de diferentes pregaduras, petos, fibelas
e botóns, amais dun cinturón; e, por iso, aínda que non estivese claro para qué
debía servir todo aquilo, parecía moi práctico. «¿Quen é vostede?», preguntou
K., incorporándose a medias na cama. O home, sen embargo, pasou por alto a
pregunta, como se houbese que tolerar sen máis a súa presencia e, pola súa vez,
dixo tan só: «¿Chamou vostede?» «Anna ten que traerme o almorzo», dixo K. e,
manténdose de inicio á expectativa, intentou descubrir e determinar quén era
realmente aquel home. Pero este non deixou que o observasen durante moito
tempo, senón que foi ata a porta e abriuna un chisto para lle dicir a alguén
que evidentemente se encontraba xusto detrás: «Quere que Anna lle traía o
almorzo». Na estancia veciña oíuse unha breve gargallada; polo son, ben podía
ser que houbese por alí varias persoas. A pesar de que o descoñecido non
puidera, deste xeito, decatarse de nada que non soubese con anterioridade,
agora díxolle a K., no ton de quen informa: «Non é posible». «Estrañaríame»,
dixo K.; saltou da cama e puxo de contado os pantalóns. «Quero ver agora mesmo
qué clase de xente hai na outra estancia e cómo a señora Grubach me xustifica
esta intromisión». Axiña caeu na conta de que non debera dicir aquilo en voz
alta e que así estaba a recoñecer dalgunha maneira o dereito a vixialo do
descoñecido; non obstante, isto non lle parecía agora importante. Polo menos,
así o entendeu o descoñecido, porque lle dixo: «¿Non prefire quedar aquí?».
«Nin quero seguir aquí, nin lle hei dirixir a palabra mentres vostede non se
presente». «Foi coa mellor intención», dixo o descoñecido e abriu voluntariamente
a porta. A estancia veciña, na que K. entrou máis de vagar do que pretendía, a
primeira vista ofrecía case o mesmo aspecto que a noite anterior. Tratábase do
cuarto de estar da señora Grubach; quizais había hoxe naquela estancia ateigada
de mobles, tapetes, porcelanas e fotografías un pouco máis de espacio que de
costume. Non se chegaba a acertar o motivo, sobre todo porque o cambio
principal consistía na presencia dun home sentado, ó pé da ventá, cun libro do
que agora alzaba a vista. «Debería quedar no seu cuarto. ¿Seica non llo dixo
Franz?». «Si que mo dixo, pero ¿que quere vostede?», preguntou K. e desviou a
mirada dende o home que acababa de coñecer ó chamado Franz, que seguía de pé na
porta, para logo volverse de novo cara ó primeiro. A través da ventá aberta
víase de novo a anciá que, con verdadeira curiosidade senil, se asomara agora á
ventá do outro lado da rúa para non perderse nada. «Quero ver axiña a señora
Grubach», dixo K.; fixo un movemento como para afastarse dos dous homes, aínda
que estaban mol separados del e fixo por avanzar. «Non», dixo o home da ventá;
lanzou o libro sobre unha mesiña e ergueuse. «Non pode marchar, vostede está
detido». «Así parece», dixo K. «¿E por que?», preguntou logo. «Non somos os
encargados de llo dicir. Volva ó seu cuarto e espere. Agora vén de iniciarse o
procedemento, saberá todo ó seu debido tempo. Excédome no meu cometido tratando
de persuadilo amigablemente. Espero que non escoite isto ninguén máis á parte
de Franz que, contra todas as normas, tamén se mostra amable con vostede. Se no
futuro ten tanta sorte coma coa designación do seu vixiante, daquela pode
sentirse confiado». K. quixo sentar, pero entón advertiu que non había ningún
asento en todo o cuarto fóra da butaca ó pé da ventá. «Xa verá cánto hai de
certo en todo isto», dixo Franz, achegándoselle xunto ó outro home. Este
último, en especial, avantaxaba a K. en altura e, de vez en cando, dáballe nas
costas. Ambos os dous examinaron o pixama de K. e comentaron que agora habería
de vestir unha camisa de moita peor calidade; que eles, así pois, lle gardarían
tanto aquela camisa coma o resto da roupa e que, se o seu caso se resolvía
favorablemente, lla devolverían de novo. «É mellor que nos entregue as cousas a
nós e non ó depósito», dixeron; «pois no depósito hai moitas subtraccións; á
parte de que alí se venden os obxectos despois dun certo tempo, sen
consideración polo feito de que o procedemento do caso estea ou non concluído.
¡E dun tempo a esta parte, canto non duran esta clase de procesos! Ó final de
todo recíbese o producto da venda do depósito; pero, de primeiras, este xa é
pequeno en si mesmo porque coa venda non se decide a contía da oferta, senón a
contía do suborno; e, en segundo lugar, porque o producto desa venda, como
indica a experiencia, vai reducíndose ano tras ano ó pasar de man en man». K. a
penas lle prestou atención a aquelas palabras; non lle outorgaba moito valor ó
dereito, que quizais aínda tiña, a dispoñer das súas cousas; moito máis
importante para el era aclarar a súa situación. Sen embargo, nin sequera daba
pensado en presencia daquela xente. Unha e outra vez sentíase empurrado pola
barriga do segundo dos gardas -non podían ser máis que gardas- de xeito case
amigable. Sen embargo, ó erguer a vista, vía, en desacordo con aquel voluminoso
corpo, un rostro seco e osudo, co nariz forte e torcido; un rostro que se
entendía por enriba da súa cabeza co outro garda. Así pois, ¿que clase de xente
era? ¿De que falaban? ¿A que organismo oficial pertencían? Aínda así, K. vivía
nun estado de dereito; en todas partes reinaba a paz, todas as leis se mantiñan
en vigor; ¿quen se atrevía a asaltalo na súa vivenda? Polo demais, sempre
tendía a tomar todo do mellor xeito posible, a crer no peor so cando chegaba, a
non tomar precaucións fronte ó futuro, por máis que todo constituíse unha
ameaza. Agora, sen embargo, non lle parecía adecuada aquela actitude; é verdade
que se podía considerar todo como unha broma, como unha broma de mal gusto que,
por razóns descoñecidas -quizais porque facía hoxe trinta anos-, prepararan os
seus compañeiros do banco. Por suposto que era posible. Quizais só cumpría rir
na cara dos gardas, e eles secundaríano. Quizais eran uns galopíns sacados de
calquera parte; o aspecto tíñano. Esta vez, sen embargo, case dende o momento
en que viu o garda Franz, estaba decidido a conservar ata a máis pequena
vantaxe que posuíse sobre aquela xente. Nisto, en que se dixese máis tarde que
non entendía unha broma, K. albiscou un perigo moi menor. Con todo, sen que de
ordinario fose o seu costume aprender das experiencias, lembraba ben uns sucesos
en si mesmos insignificantes nos que, a diferencia dos seus amigos, se
conducira ás toas de xeito consciente, sen consideración ningunha polas
posibles consecuencias; algo polo que ó final tivera que pagar. Non debía
volver a suceder, polo menos nesta ocasión. Se se trataba dunha comedia, quería
participar.
Aínda estaba libre. «Con permiso», dixo e pasou á présa
por entre os gardas, camiño do seu cuarto. «Parece que se comporta razoablemente»,
sentiu dicir detrás del. No seu cuarto, abriu de inmediato os caixóns do
escritorio. Dentro estaba todo perfectamente ordenado; pero xusto a súa
documentación, que era o que procuraba, non a atopou de contado por culpa da
excitación. Por fin deu co documento da súa bicicleta e quixo entregárllelo
axiña ós gardas; pero logo considerou aquel papel insignificante por demais e
seguiu buscando ata dar coa partida de nacemento. Xusto cando volvía á estancia
veciña, abriuse a porta de en fronte; e a señora Grubach quixo entrar. Foi só
un momento porque, a penas recoñeceu a K., quedou obviamente confusa;
desculpouse, retirouse e, por último, pechou a porta con coidado. «Entre»,
aínda chegou a dicir el. Agora, sen embargo, atopábase en medio do cuarto cos
seus papeis; ollou de novo cara á porta, que xa non volveu abrirse, e
sobresaltouse coa chamada dos gardas que sentaran xunto á mesiña ó pé da ventá
aberta e que, como comprobou K. agora, comían o seu almorzo. «¿Por que non
entrou ela?», preguntou. «Non pode», dixo o garda máis alto. Vostede seque
detido». «¿Como é posible que estea detido e deste xeito, ademais?» «Daquela,
volve agora coas mesuras», dixo o garda e mollou unha rebanda de manteiga no
tarro do mel. «Non respondemos tales preguntas». «Terá que respondelas», dixo
K. «Velaquí está a miña documentación; amóseme agora a súa e, sobre todo, a
orde de detención». «¡Vaia por Deus!», dixo o garda; «está claro que non pode
aceptar a súa situación e aínda por riba parece empeñado en amolarnos
inutilmente; a nós, que agora probablemente somos, de entre todas, as persoas
máis achegadas a vostede». «Élle así, ¿por que non o cre?», dixo Franz; que non
levou á boca a taza de café que sostiña na man, senón que observou a K. cunha
ollada longa e moi significativa, aínda que incomprensible. Sen querer, K. deu
en intercambiar olladas con Franz; logo, sen embargo, colleu os seus papeis e
dixo: «Velaí a miña documentación». «¡E a nós que nos importa!», exclamou
daquela o garda máis alto. «Compórtase peor que un neno. ¿Que pretende?
¿Pretende con isto chegar axiña ó final do seu maldito gran proceso? ¿Discutir
connosco, os gardas, acerca de documentos de identidade e de ordes de
detención? Somos humildes empregados que case non entenden de documentos de
identidade e que non teñen outra cousa que facer no seu caso que cumprir as
correspondentes dez horas diarias de vixilancia, que para iso nos pagan. Iso é
todo o que nós somos, aínda a pesar de que podemos comprender que os
funcionarios superiores dos que dependemos, antes de ordenar unha detención
así, se informan concienciudamente sobre os motivos da detención e sobre o
detido. Acerca disto non hai erro posible. A nosa Administración, polo que
coñecemos, e coñecemos tan só os niveis máis baixos, non procura a culpa entre
a poboación, senón que, como di a lei, é atraída pola culpa e ten que enviarnos
a nós, os gardas. Velaí a lei. ¿Onde ía haber erro?». «Non coñezo en tal lei¡»,
dixo K. «Tanto peor para vostede», dixo o garda. «Tan só existe nas súas
cabezas», dixo K., que quería penetrar como fose nos pensamentos dos gardas
para volvelos ó seu favor ou afacerse a eles. Pero o garda limitouse a dicir fríamente:
«Xa se informará». Franz interveu para dicir: «Fíxese, Willem; admite que
descoñece a lei e, á vez, afirma que é inocente». «Levas toda a razón, pero non
se lle pode facer entender nada», dixo o outro. K. xa non respondeu. ¿Debo
deixarme confundir, pensou, pola leria destes funcionarios subalternos, que iso
foi o que admitiron ser? Falan de cousas das que, en calquera caso, malamente
entenden algo. A súa seguridade baséase exclusivamente na súa estupidez. Un par
de palabras con alguén que estea á miña altura han servir para aclaralo todo
mellor que a máis longa das conversas con estes. Foi varias veces dun lado a
outro polo espacio libre do cuarto; en fronte viu a anciá, que levara ata a
ventá a un vello aínda de maior idade ó que tiña abrazado. K. debía poñerlle
fin a aquel espectáculo: «Lévenme onda o seu superior», dixo. «Cando el o
desexe, non antes», dixo o garda que respondía por Willem. «E agora
aconséllolle -recomendou- que volva ó seu cuarto e, sen moverse de alí, agarde
polo que se dispoña acerca de vostede. Aconsellámoslle que non se extravíe con
pensamentos inútiles, e prepárese porque se lle vai esixir moito. Non nos
tratou como se merecía a nosa boa vontade; esqueceu que, con independencia do
que se poida pensar, somos, agora polo menos e ó contrario que vostede, homes
libres; que non é unha pequena diferencia. Con todo, estamos dispostos, se ten
diñeiro, a traerlle un almorciño da cafetería de en fronte».